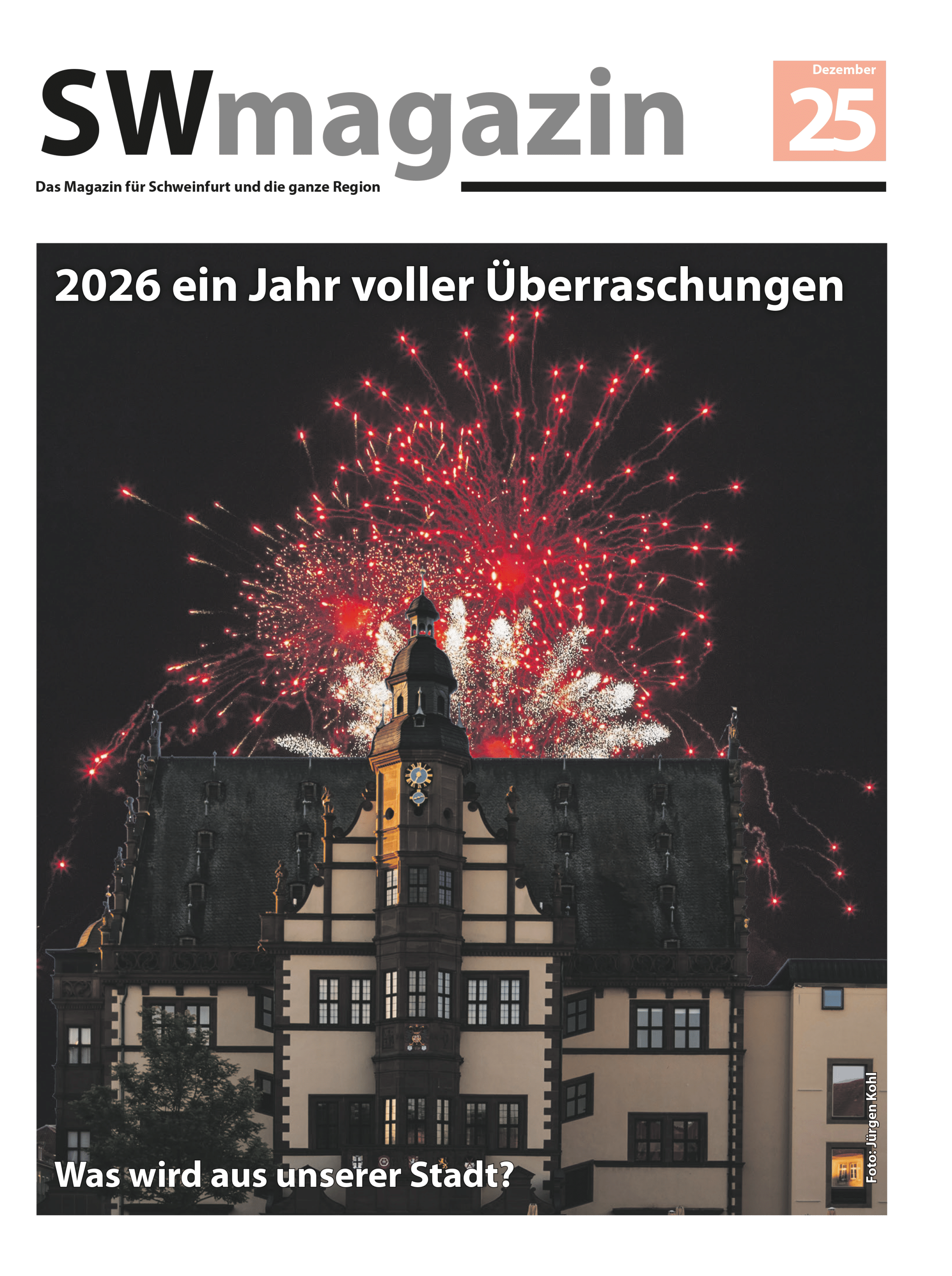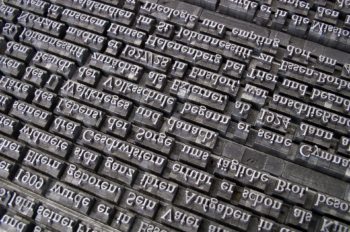Erneuerbare Energien, Windräder, Solarmodule, Biogasanlagen sollen in absehbarer Zukunft den Strombedarf der Deutschen zu 100% decken. Ist das aus Ihrer Sicht überhaupt technisch realistisch?
Gerd Bock: Die Techniken sind theoretisch vorhanden, wir bräuchten jedoch, was die Speicherfähigkeit betrifft, eine enorme Entwicklungssteigerung. Die haben wir schlicht verschlafen. Es ist heute noch nicht einmal möglich z. B. die Sonnenenergie vom Tag für die Nacht zu speichern. Noch viel schwieriger ist es, die Sonnenenergie vom Sommer für den Winter zu erhalten. Technisch gibt es schon Ansätze, diese sind aber fern von jeder Wirtschaftlichkeit. Große Pumpspeicherkraftwerke, bei denen am Tag mit Fotovoltaikstrom Pumpen betrieben werden und in der Nacht das herabstürzende Wasser die Generatoren betreiben, kosten viel Geld, sind sehr mit starken Eingriffen in die Natur verbunden und daher bei uns sicher nicht überall durchzusetzen.
Das Schlagwort ‚Methanisierung‘ scheint doch der Stein der Waisen, was die Speicherung anbelangt?
Gerd Bock: Im Labor funktioniert das Ganze. Wirtschaftlich sinnvoll wird das aber nur im großtechnischen Stil sein. An den geeigneten Standorten müssen Gasleitungen vorhanden sein und entsprechende Stromleitungen zur Versorgung. Überschüssigen Strom aus den erneuerbaren Energien wandeln wir über Wasserstoff und Zusatz von CO2 in Methan um – daher der Name dieser Technik. Gespeichert wird die Energie in Form von Gas in dem vorhandenen Gasversorgungsnetz. Geschätzt dauert es aber noch zehn Jahre, bis es realistisch zur großtechnischen Anwendung kommt.
Energie war und ist heute immer noch das Rückgrat der Wirtschaft. Bayern hat immer versucht ein bisschen unabhängig, auch von anderen Bundesländern zu bleiben. Ist diese Unabhängigkeit jetzt in Gefahr?
Gerd Bock: Bayern war früher ein reines Agrarland. Mit der Industrialisierung einhergehend, hat man Energie in größerem Umfang gebraucht, in erster Linie Strom, um Maschinen antreiben zu können. Man hat immer schon versucht, Energie möglichst nahe am Verbraucher zu erzeugen. In Bayern ging die Entwicklung nicht so schnell voran wie z. B. in Nordrhein-Westfalen. Dort waren große Kohlelagerstätten vorhanden und was lag näher als Kohle zur Stromerzeugung zu nutzen. Die Stahlproduktion war energiehungrig und ist es auch heute noch. In Bayern gab es diese Voraussetzungen nicht. Die Kernkraft war zum Zeitpunkt des wachsenden Energiehungers in Bayern eine Option, um unabhängig, kostengünstig und zuverlässig Strom erzeugen zu können. Im Wesentlichen wird heute der Strombedarf, den wir in Bayern benötigen, auch im Land selber erzeugt. Das wird sich in naher Zukunft ändern.
Warum ist es so schwierig, den heute regenerativ erzeugten Strom in das bestehende Netz einzuspeisen?
Gerd Bock: Früher waren die Stromversorgungsnetze – historisch bedingt – nur für den Verbrauch ausgelegt. Heute haben wir bei der ÜZ Zeiten, in denen wir viel mehr Strom in das Netz einspeisen müssen als verbraucht wird. Beispielsweise hatten wir heuer über Ostern, von Karfreitag bis Ostermontag, mit fast 30.000 kW Überschussleistung zu kämpfen. Diese knapp 30.000 kW müssen abtransportiert werden. Man könnte sagen: sonst steigt im Netz der ‚Wasserstand‘, um das einmal so zu vergleichen. Abflussmöglichkeiten sind keine vorhanden. Man kann die Verbraucher nicht anweisen: Jetzt werden alle möglichen Verbraucher eingeschaltet.
Dies war für uns der Grund im letzten Jahr in Heidenfeld ein Umspannwerk zu bauen, um zusätzlich ‚Abflussmöglichkeiten‘ in die höhere Spannungsebene zu schaffen. Wir haben also ein ‚Ventil‘ zum 110-kV-Netz eingebaut, um den Strom über dieses Netz verteilen zu können und wir müssen weiterhin unser Netz ausbauen und weitere ‚Abflussmöglichkeiten‘ schaffen, weil wir auf dem Lande, im Gegensatz zu den umliegenden Städten, naturgemäß weitaus mehr regenerative Energien aus Fotovoltaik und Windkraft einspeisen müssen, aber nicht über große Verbrauchseinheiten verfügen. Die regenerativen Stromquellen haben Vorrang und müssen nach der Gesetzeslage vorrangig ins Netz aufgenommen werden, egal ob die Energie gerade gebraucht wird oder nicht.
Es scheint, dass die Netze für diese Art der Stromerzeugung nicht ausgelegt sind?
Gerd Bock: Früher hat man die Stromversorgung ähnlich wie eine Baumstruktur aufgebaut. Die Wurzeln waren die Kraftwerke und die Energie wurde erst durch sehr dicke, dann dünnere Äste, hinauf zu den Zweigen und Früchten transportiert. Plötzlich entstehen nun oben im Baum kleine, mittlere und auch große Kraftwerke, die versuchen ihren Strom von der anderen Seite her einzuspeisen. Wir Netzbetreiber müssen jetzt im Baum andere neue Verbindungen herstellen, damit zwischen Erzeugung und Verbrauch wieder das Gleichgewicht hergestellt ist. Wenn wir unsere Netze nicht ständig auf den neuesten Stand bringen würden, müssten wir als letzte Konsequenz einzelne Einspeiser abschalten, bevor Leitungen überlastet würden. Dies ist bei der ÜZ noch nicht vorgekommen.
Wie kann man als kleine, regionale Genossenschaft diese Investitionen überhaupt stemmen, um technisch da immer auf dem Laufenden zu sein?
Gerd Bock: Unsere Einnahmen sind die Netzentgelte. Das bedeutet für unsere Kunden natürlich eine höhere Belastung im Vergleich zu Städten, die nicht so viele Einspeiser haben. Dort sind kaum Investitionen zu einem schnellen Netzausbau nötig wie auf dem flachen Land.
Ist es nicht so: Je mehr Erneuerbare dazu kommen, desto schwieriger wird die Stabilisierung des Netzes?
Gerd Bock: Wenn an einem schönen Sonnentag auch noch der Wind richtig weht, ist es unsere Aufgabe, die Energie so aufzunehmen, dass es zu keinen Versorgungsstörungen unserer Kunden kommt und die Einspeiser ihren Strom bei uns abliefern können. Wir benötigen dazu mehr und stärkere Leitungen. Jetzt wird es aber Abend, die Sonne geht unter und es wird windstill. Unsere regenerativen Kraftwerke liefern nach und nach keinen Strom mehr, die Spannung sinkt und die Frequenz nimmt ab. Nun brauchen wir die konventionellen Kraftwerke im Hintergrund, um das Netz zu stabilisieren.
Oder nehmen wir ein Beispiel aus dem Alltag: Ein Bagger zerreißt bei Bauarbeiten eine unserer Leitungen ab, was ja auch vorkommt. Mit Fotovoltaik und Windkraft bekommen wir nicht die notwendige Leistung, um das Netz stabil umschalten zu können. Wir sind also immer auf Kraftwerksleistung im Hintergrund angewiesen. Die Kilowattstunden, also die physikalische Arbeitsmenge, werden aus erneuerbaren Energieerzeugungsanlagen wetterabhängig bereitgestellt. Die Verfügbarkeit eines Kraftwerkes können sie nicht ersetzen. Im letzten Winter haben wir über 20 Tage lang kaum eine Kilowattstunde aus Fotovoltaik und Windkraft in das Netz aufgenommen. Es war windstill und die Fotovoltaikanlagen mit Schnee bedeckt.
Welche Hebel haben die Techniker in Lülsfeld dann gedreht, um einen drohenden Blackout abzuwenden?
Gerd Bock: Wir haben unser Leitungsnetz, um das Netz stabil zu halten. Fehlende Strommengen beziehen wir aus dem vorgelagerten Netz. Dazu haben wir feste Lieferverträge mit verschiedenen Anbietern. Wichtig ist für uns eine vorausschauende Handlungsweise.
Wir müssen wissen, wie sich der Verbrauch entwickelt. Da ist viel Erfahrung im Spiel und dazu haben wir Profis.
Die Ware Strom wird doch dabei immer teurer?
Gerd Bock: Ja, da ist einmal die eingangs diskutierte Einspeisevergütung. Der Strom wird auch deshalb teurer, weil zweitens die Fixkosten gleich bleiben, egal ob viel oder wenig Strom produziert wird. In den vorhandenen Kraftwerken werden mit steigendem Einsatz regenerativer Energien immer weniger Kilowattstunden erzeugt werden. Abschalten geht nicht, da es Zeiten ohne Wind- und Sonnenenergie gibt.
Gibt es Abschätzungen zu den Preisen, die für den Verbraucher da herauskommen?
Gerd Bock: Je nach Sichtweise geben die Verbände unterschiedliche Prognosen ab. Die DENA (Deutsche Energieagentur) spricht von vier bis fünf Cent pro Kilowattstunde, die der Strom teurer wird. Das wären für einen normalen Haushalt rund 160 Euro im Jahr höhere Stromkosten.
Das klingt ja, auch wenn man die pessimistischte Einschätzung nimmt, nicht astronomisch viel?
Gerd Bock: Das klingt zunächst nicht besonders hoch. Was machen aber gewerbliche Abnehmer mit Stromrechnungen mit einigen zig Tausend Euro? Was passiert in der Industrie? Sollten wie angedacht die Mehrkosten nicht auf die Industrie umgewälzt werden, sondern nur auf die Privathaushalte, dann stimmt die DENA-Einschätzung natürlich nicht mehr. Dann sind wir schnell beim doppelten Preis.
Belasten wir die Industrie zu stark, gefährden wir unsere Arbeitsplätze.
Wie groß ist die Gefahr eines Blackouts, wenn der Winter kommt?
Gerd Bock: Im Moment sind acht Kernkraftwerke vom Netz genommen und werden nach dem Beschluss der Bundesregierung auch nicht mehr angefahren. Zurzeit haben wir einen Importüberschuss, früher hat Deutschland immer Strom exportiert. Im kommenden Winter werden wir mehr Strom importieren müssen. Erfahrungen mit einem Winter ohne diese acht Kernkraftwerke gibt es noch nicht. Setzt eine Witterungsänderung jedoch schlagartig ein (z. B. ein Kälteeinbruch), kann es kritisch werden. Vor Jahren genügte ein Schiffstransfer im Mittellandkanal, bei dem eine 380-kV-Leitung abgeschaltet wurde, um halb Europa bis nach Spanien einen Blackout zu bescheren.
Wenn nicht genügend Kraftwerksreserven vorhanden sind, sind solche Zwischenfälle nicht mehr beherrschbar.
Zu Großvaters Zeiten hat es nach einem Gewitter oft Stunden gedauert, bis das Stromnetz wieder stabilisiert war. Das ist heute unvorstellbar. Heute haben wir im Netz der ÜZ 2,4 Minuten Netzausfallzeit pro Kopf und Jahr, bundesweit sind es 14 Minuten. Diese Zeiten müssen wir jedes Jahr an die Bundesnetzagentur melden. Die Netzagentur überprüft damit die Qualität der Netze. Wir haben bei der ÜZ sensationell gute Werte. In anderen europäischen Ländern haben wir Ausfallzeiten von 30 Minuten und mehr.
Kann sich in Zukunft eine kleine Genossenschaft wie die ÜZ in Zukunft überhaupt auf dem Markt behaupten?
Gerd Bock: Das ist eine Frage der Qualität und der Firmenphilosophie. Rechtzeitig investieren, das hat die ÜZ in der Vergangenheit immer gemacht, und unsere Technik ist auf dem neuesten Stand. Unsere Profis in der Leitstelle können durch eine Vielzahl von Überwachungsgeräten sehr schnell reagieren. Das wollen wir demnächst mit einem Pilotprojekt auch auf der Niederspannungsseite realisieren, allein wegen der Vielzahl der einspeisenden Fotovoltaikanlagen. Darüber hinaus haben wir selbst direkt in regenerative Energien investiert. In Schonungen bauen wir mit einem Partner fünf Windräder, in Schwanfeld läuft ein Projekt, andere sind in der Planung. Auch außerhalb unserer Region sind wir aktiv. Vor der Zukunft haben wir keine Angst, wir sind zum nachhaltigen Wirtschaften zum Wohle unserer Mitglieder und Kunden bereit. Wir denken im Übrigen auch über Kraftwerksanteile an konventionellen Kraftwerken nach.
Wir danken Ihnen für dieses ausführliche Gespräch.
Der Geschäftsführende Vorstand der Unterfränkischen Überlandzentrale eG ist gebürtiger Kitzinger und wohnt heute im Biebelrieder Ortsteil Kaltensondheim. Er ist verheiratet und Vater von fünf erwachsenen Kindern. In Schweinfurt studierte er Energietechnik. Nach zweieinhalb Jahren bei der Firma Knauf in
Iphofen wechselte der 55-Jährige 1984 zur damaligen ÜWU AG (heute E.ON Bayern AG), wo er im technischen Betrieb bei der Nutzung regenerativer Energien und Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen und die letzten neun Jahre im Vertrieb beschäftigt war. Am 1. Dezember 2007 kam er zur ÜZ nach Lülsfeld.