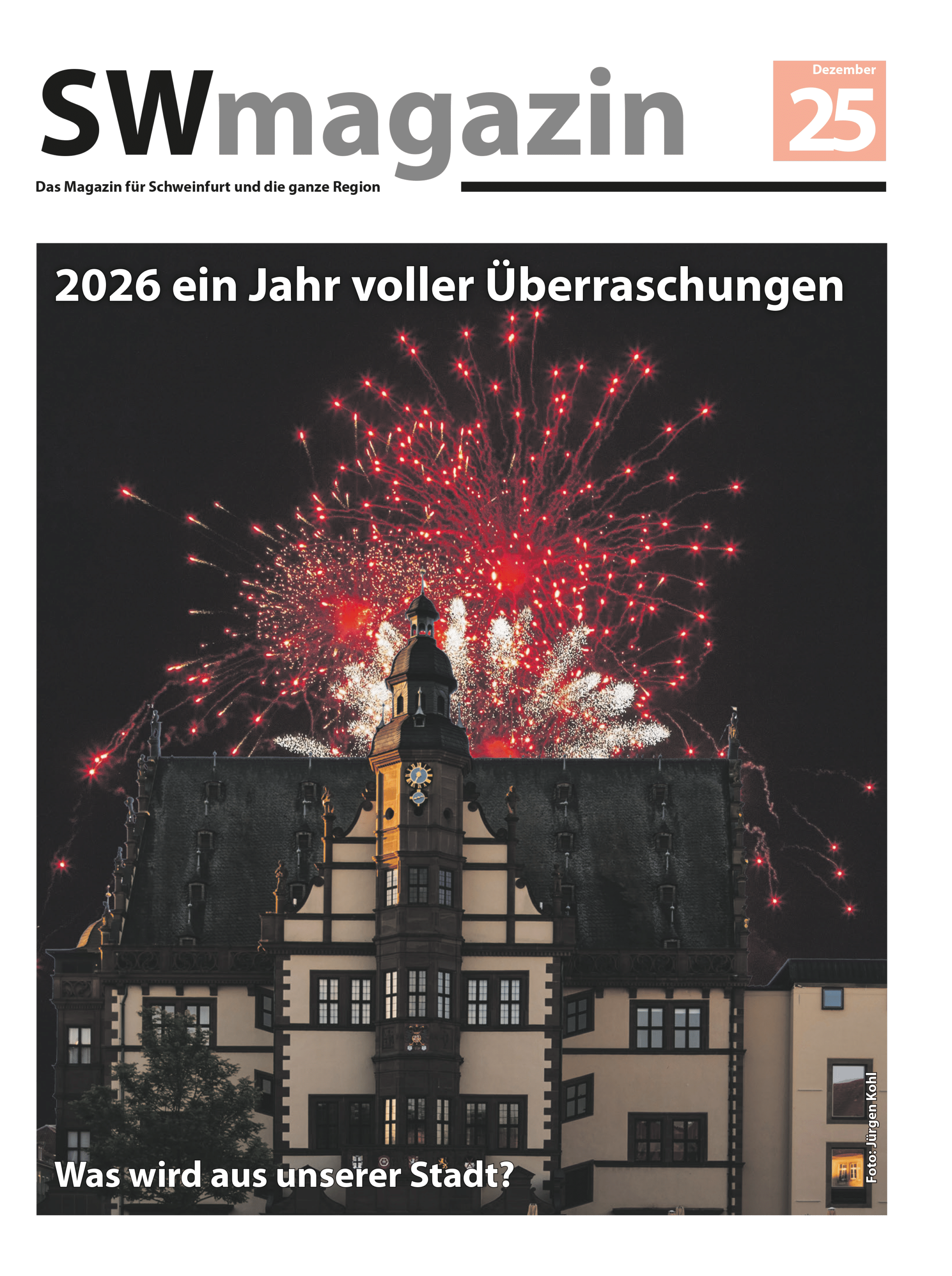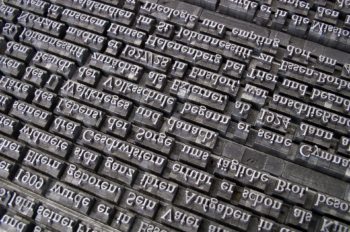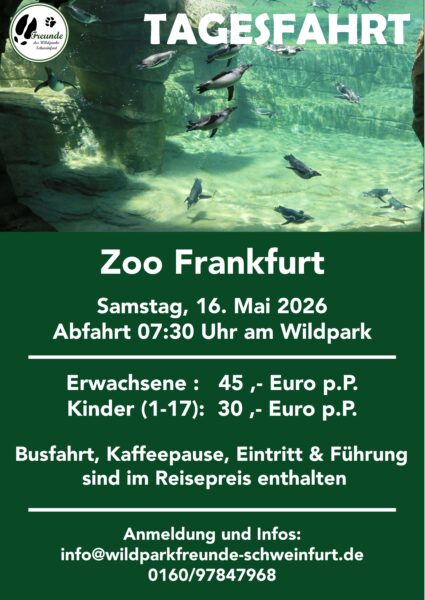Geht die Atomzeit mit der Abschaltung von Grafenrheinfeld jetzt wirklich zu Ende? Prof. Paulus: Grafenrheinfeld ist ja die Anlage, die nach dem Ausstiegsbeschluss 2015 vom Netz gehen soll. Es ist nicht die letzte Anlage, die vom Netz geht, danach kommen noch einige, Gundremmigen B im Jahr 2017 und dann die neueren Anlagen bis 2022. Von den Anlagen, die jetzt noch in Betrieb sind, ist Grafenrheinfeld aber die erste, die abgeschaltet werden soll. Man hat die alten Siedewasserreaktoren, Isar 1, Philippsburg 1, Brunsbüttel und Krümmel sowie die alten Druckwasserreaktoren, Neckarwestheim 1, Biblis A und B und Unterweser durch die Änderung des Atomgesetzes abgeschaltet. Grafenrheinfeld gehört vom Typ als sogenannte Vor-Konvoi-Anlage zu den neueren Anlagen, die z.B. auch einen Schutz gegen den Absturz größerer Flugzeuge haben.
Ist das wirklich das Ende der Energieerzeugung durch Kernkraft oder kommt noch einmal eine ‚Rolle rückwärts‘? Besteht mit den erneuerbaren Energien überhaupt die Chance den Strombedarf zu decken?
Prof. Paulus: Langfristig gesehen, das sind jetzt Zeiträume von mehr als zehn bis zwanzig Jahren, müssen wir als Menschheit ohne fossile Energieträger und auch ohne Kernenergie auskommen. Ob das jetzt kurzfristig zu machen ist, da habe ich meine großen Zweifel. So wie wir die Energiewende jetzt anpacken, ist es abzusehen, dass das nicht funktioniert. Es gibt eine Vielzahl von Gründen, warum das schwierig wird. Das politische Ziel ist ehrgeizig, aber es ist viel Wunschdenken dabei. Der politische Wille ist da und auch die Bürger wollen, so scheint es, aus der Kernenergie aussteigen, jedenfalls bei uns in Deutschland. Dass einer in Deutschland auf die Idee kommt, in einigen Jahren neue Kernkraftwerke zu bauen, kann ich mir nicht vorstellen. Wenn aber in den nächsten Jahren reihenweise Netzzusammenbrüche kommen, dann reift vielleicht die Erkenntnis:
So haben wir uns das nicht vorgestellt mit der Energiewende, dass wir tagelang in bestimmten Regionen von der elektrischen Versorgung abgeschnitten sind. Man wäre dann sicher in der Lage, da und dort wieder Laufzeiten zu verlängern. Wenn man also diesen Ausstiegsbeschluss ernst nimmt, wird man nicht daran vorbeikommen, wieder mehr fossile Energieträger einzusetzen, also Braunkohle, Steinkohle, Öl mit allen Nachteilen wie CO2-Emmissionen und weitere Belastungen der Umwelt, mit Abhängigkeit von Quellen, die nicht bei uns vorhanden sind. Wenn wir uns die Strommenge anschauen, die bei uns benötigt wird, verteilt über ein ganzes Jahr, dann kommen 23% aus Kernenergie, 23% aus Braunkohle, 20% aus Steinkohle und 13% aus Erdgas, was auch zu den fossilen Energieträgern zählt. Wenn wir das also zusammenzählen, sind wir bei einem Anteil von fossilen Energieträgern, inkl. Kernkraft, von rund 80% bei der Stromerzeugung. Bei der Wärmeerzeugung und beim Verkehr sieht das noch schlimmer aus. Diesen Anteil aus Klimaschutzgründen zu drücken, war ja im letzten Jahr der Grund gewesen die Laufzeiten der Kernkraftwerke zu verlängern. Von diesem Ziel hat man sich mit dem erneuten Ausstiegsbeschluss verabschiedet. Ich sehe keine Möglichkeit, wie man den Anteil der fossilen Energieträger und den Anteil, der nach dem Abschalten der Kernkraftwerke fehlt, regenerativ ersetzen kann.
Ich kann doch für jedes Kernkraftwerk eine entsprechende Anzahl von Windrädern hinstellen, gemischt mit großen Fotovoltaikanlagen, um die Bedarfslücke zu füllen?
Prof. Paulus: Wenn man rund 2500 Windräder auf die Höhen um Schweinfurt herum aufbauen würde, hätte man rein rechnerisch ungefähr die gleiche Jahresstrommenge wie Grafenrheinfeld erzeugt. Die Frage ist aber, ist der Strom auch dann verfügbar wenn er gebraucht wird? Der Wind ist nicht steuerbar und richtet sich nicht nach unserer Tageslastkurve, die den Verbrauch im Verlauf eines Tages anzeigt. Also Angebot und Nachfrage sind nicht deckungsgleich. Beim Wind sieht das grundsätzlich eigentlich viel besser aus als bei der Solarenergie.
In unseren Breitengraden halte ich die Fotovoltaik für eine absolute Fehlinvestition.
Wenn wir sehr viele Windräder bauen, ist es realistisch, den Stromverbrauch zu einem hohen Anteil daraus zu decken. In Zeiten, in denen ein zu hohes Angebot an Strom mit Wind produziert wird, müsste man die Windräder einfach abschalten, weil das Angebot im Netz nicht unterzubringen ist. Wir müssen also versuchen über Pumpspeicherkraftwerke, über Methanisierung oder ähnliches den Überschuss sinnvoll zwischen zu speichern, um windstille Zeiten überbrücken zu können. Die Steuerung der Windkraftanlagen ist nicht mehr das Problem, man kann moderne Anlagen auch in die Regelleistung einbinden.
Was ist das‚ Regelleistung?
Prof. Paulus: Es gibt verschiedene Faktoren, die bei einem Stromnetz von Bedeutung sind. Das eine ist die Tageslast. Frühmorgens um vier sind die Verbräuche noch gering, sie steigen erst langsam an. Die Firmen fangen an zu arbeiten. Zur Mittagszeit geht das Ganze wieder langsam runter, um dann gegen Abend neue Spitzen zu erreichen. Also, gehen wir davon aus, dass genügend Windkraftanlagen in Betrieb sind, dann müsste man am frühen Morgen die meisten abgeschaltet lassen. Technisch kein großes Problem, das kann man fernsteuern und funktioniert bei allen neueren Anlagen, zumindest wären sie nachrüstbar. Wenn jetzt plötzlich starker Wind weht, die Anlagen schlagartig mehr Strom erzeugen, müssten noch mehr Windkraftanlagen abgeschaltet werden. D.h. die vorhandene Kraftwerksleistung muss immer dem Verbrauch exakt nachgeregelt werden. Diese Primärreglung ist zur Zeit recht komfortabel. Die deutschen Kernkraftwerke, Braunkohle- und Steinkohlekraftwerke haben in ihren Rohrleitungen immer Dampf, haben die großen Schwungmassen der Generatoren und der Turbinen. Wenn jetzt plötzlich die Nachfrage wieder steigt, weil, nehmen wir an viele Leute gleichzeitig ihren Herd anschalten, sinkt die Frequenz im Stromnetz ab und die großen Schwungmassen und der Dampf in den Rohrleitungen bieten genug Leistungsreserve. Man nennt dies Primärregelung.
Wenn ich die großen Kraftwerke nicht mehr habe, muss ich mir was anderes einfallen lassen, z.B. Gasturbinen, die immer mitlaufen und schnell geregelt werden können. Alternativ muss ich versuchen die Windanlagen in eine schnelle Lastregelung einzubinden. Voraussetzung ist, dass wir alle kleinen dezentralen Anlagen erst einmal untereinander vernetzen und einem einheitlichen Management unterwerfen. Zurzeit ist es überhaupt nur deshalb möglich große Mengen regenerativer Erzeuger einzuspeisen, weil man noch die großen konventionellen Kraftwerke und Kernkraftwerke hat.
Das hört sich für die Freunde der regenerativen Stromerzeugung schon ein bisschen seltsam an? Welche Änderungen müssten an den bestehenden Netzen vorgenommen werden, um auf die stabilisierende Wirkung dieser Grundlastkraftwerke verzichten zu können?
Prof. Paulus: Von der Philosophie der modernen Stromversorgung gehen wir ein paar Schritte rückwärts, so wie wir das am Anfang hatten, so Anfang des 20. Jahrhunderts. 1910 hatte man nicht so viele große Energieversorger wie heute. Einzelne Stadtwerke haben einen regionalen Kreis gebildet und sich quasi autark verhalten. Später kamen die großen Übertragungsstrecken dazu, man konnte sich Strom beim Nachbarn dazu holen. Mit den großen Leitungen, quer durch die Republik und zu den europäischen Nachbarn, ist die Versorgung kein Problem. Das Stabilitätsproblem muss aber jetzt vermehrt wieder vor Ort gelöst werden.
Gleicht das dem Versuch, von zu Hause Wasser in die allgemeine Wasserversorgung einzufüllen, von rückwärts also?
Prof. Paulus: Ja, das kann man schon vergleichen. Es gibt so ein Gedankenmodell wie unser Stromnetz funktioniert. Man muss sich das wie ein großes Wasserbecken vorstellen, die Füllhöhe muss immer konstant sein und zwar auf den Millimeter genau. Ich muss also immer genau so viel Wasser einfüllen wie unten rausläuft. Was jetzt nicht passieren darf, ist, dass ich an der einen Seite einen dicken Schlauch reinhalte und auf der anderen Seite das Wasser rauslasse. Dann habe ich, obwohl die Menge gleich bleibt, einen schiefen Pegel – ich erzeuge eine Welle. Übertragen auf das Stromnetz bedeutet das, dass überall dort wo Verbraucher sind haben wir auch Erzeugungsanlagen. Kraftwerke sind möglichst nahe an die Zentren gebaut worden. Die großen Übertragungsnetze waren ursprünglich nur als Sicherheitsnetz gedacht. Die Idee war, jede Region kann sich selbst versorgen.
Wenn aber mal ein Kraftwerk ausfällt, kann über die großen 380-KV-Anlagen Strom besorgt werden. Um aber jetzt große Strommengen regelmäßig von Nord nach Süd zu transportieren, wie mit dem Bau der großen Offshore-Wind-Anlagen geplant, fehlen uns schlicht Leitungen.
In Bayern liegt der Anteil der Kernenergie bei der Stromerzeugung im Jahr über 60 Prozent, das soll 2015 dann einfach wegfallen?
Prof. Paulus: In Bayern wurden im Jahre 2010 ca. 45 Terrawattstunden durch Kernkraft erzeugt, das waren 61%. Da bleibt eine Lücke von ungefähr 6000 MW, die es zu ersetzen gilt. Ein modernes Windrad erzeugt zurzeit 3 MW. Das würde, bei 20% Volllaststunden gerechnet ungefähr 10.000 Windanlagen für Bayern bedeuten; damit hätten wir nur die Strommenge. An manchen Tagen hätten wir halt überhaupt keinen Strom, weil einfach kein Wind weht.
Wir können noch so viele Windräder bauen, statistisch gibt es z.B. Ende Januar eine Kaltwetterphase, kalt und ohne Wind. Die kann wie im letzen Jahr 21 Tage andauern. Solarenergie war in diesen Tagen auch nicht zu ‚ernten‘. Für diese 21 Tage müssten wir ja den Strom ebenso bereitstellen. Nehmen wir an, es würden in Deutschland wirklich so viele Windräder gebaut werden, um damit an 360 Tagen im Jahr den gesamten Bedarf komplett decken zu können, müssten wir für die rechnerisch angenommenen fünf Flautetage in der Spitze immer noch 80.000 MW an Leistung vorhalten und zwar vornehmlich aus Gaskraftwerken, wenn wir keine Kohle- und Kernkraftwerke wollen. Ein gutes, modernes Gasturbinenkraftwerk, das wäre die umweltfreundlichste Alternative, hat ungefähr 300 MW an elektrischer Leistung. Um die genannten 80.000 MW abzudecken, brauchen wir jetzt rund 250 von diesen Kraftwerken, zusätzlich 10 bis 15 Prozent Reserve, um nicht zu riskieren, dass es im Winter zu einem Blackout kommt. Das ganze Jahr müssen die Anlagen personell besetzt sein. Alle Anlagen müssen immer darauf vorbereitet sein, sofort angefahren werden zu können. Das kann man technisch machen, nach der Wirtschaftlichkeit fragen wir mal lieber nicht. Eine Anlage ist wie jede andere Maschine dann wirtschaftlich, wenn sie rund um die Uhr läuft. Die Anlagen werden nicht besser, wenn sie nur in Bereitschaft stehen.
Es führt an der Speicherung in irgendeiner Form kein Weg vorbei?
Prof. Paulus: Der einzige Ausweg scheint die Methanisierung von Windstrom zu sein. Die Erzeugung ist nicht sehr kompliziert, man nimmt den Strom aus der Windkraftanlage und spaltet mit dem Strom Wasser per Elektrolyse. Dabei entsteht Wasserstoff und Sauerstoff. Durch eine chemische Reaktion des Wasserstoffs mit Kohlendioxid, das man sich aus der Luft oder aus Abgasen holt, entsteht dann Methan. Das ist nichts anderes als Erdgas, nur synthetisch erzeugt. Der Wirkungsgrad ist mit ca. 60 % nicht berauschend, aber wir haben einen ganz großen Vorteil. Das Gasnetz, welches wir hier bei uns haben, ist als Speicher geeignet.
Ungefähr 130 Terrawattstunden, in Strom umgerechnet, könnten wir in diesem Netz speichern.
Das wäre Reserve für mehrere Wochen an denen kein Wind weht. Die damit betriebenen Gaskraftwerke könnte man guten Gewissens auch als Grundlastkraftwerke und zur Bereitstellung von Regelleistung mitlaufen lassen. Sie würden nur Gas verbrauchen, das vorher mal Windstrom war. Die Verfahrensweise wird zur Zeit schon im größeren Labormaßstab erprobt. So richtig im großen, industriellen Maßstab fehlen da schon noch Erfahrungen. Da braucht es sicherlich noch mindestens zwei Generationen von Anlagen, bis das im industriellen Stil läuft. Es gibt noch keine Anlagen, die man bei Siemens oder wo anders bestellen kann. Es gibt noch nicht einmal Versuchsanlagen im großen Stil.
Spielt die Fotovoltaik in Ihren Überlegungen überhaupt keine Rolle?
Prof. Paulus: Fotovoltaik ist eigentlich der größte Unfug, den man hier in unseren Breiten machen kann. Zurzeit trägt die Fotovoltaik bei uns in Deutschland zu ca. 3% zur Stromerzeugung bei, frisst aber 55% der gesamten Förderung der erneuerbaren Energien. Im Winter, bei der größten Stromnot, ist sie eigentlich überhaupt nicht vorhanden und hat Entstehungskosten von zurzeit ca. 28 bis 30 Cent pro kWh. Beim Vergleich der Leistung pro Hektar und Jahr schneidet die Freiflächenanlage besonders schlecht ab. Sie hat 300 KW pro ha, eine Windkraftanlage liegt bei über 2000 KW, wenn man die Anlagen höher baut auch darüber.
Trotzdem hat die Fotovoltaik einen in der öffentlichen Meinung höheren Sympathiewert als die Windkraft. Woran liegt das?
Prof. Paulus: Dieses Paradoxon ist aus wissenschaftlicher Sicht nicht zu verstehen. Wir bürden uns als Gesellschaft eine Schuld von bald 100 Milliarden Euro auf, um in der Zukunft, auf die Laufzeit betrachtet, 3% unseres Strombedarfs mit Fotovoltaik zu decken. Das ist eigentlich nur mit Emotionen zu erklären, eine perfekte Lobbyisten-Maschinerie hat perfekte Beteiligungsprodukte verkauft an großen Anlagen mit garantierter Rendite. Windkraft hatte nichts innovatives neues, das sieht schon so aus wie alte mechanische Technik. Das setzte sich natürlich in den Köpfen fest. Wenn man das auf den Punkt bringt, müsste man eigentlich die Solarförderung und auch die Biogasförderung sofort streichen. Die rund hundert Milliarden würden aber trotzdem als Schuld erhalten bleiben.
Ist die ganze Energiewende eigentlich keine Wende sondern eine politische Verzweiflungstat?
Prof. Paulus: Ich halte die ganze Vorgehensweise nach Fukushima für eine politische Panikreaktion. Samstag das Unglück in Japan, man hat gemerkt die Stimmung kippt, Umfragen sind heute ja sehr schnell. Übernacht haben Politiker ein lang diskutiertes Energiekonzept über den Haufen geworfen. Im Herbst 2010 wurde dieses ursprüngliche Energiekonzept mühsam verabschiedet. In den kommenden zehn Jahren wollte man den Anteil der regenerativen Energien langsam hochfahren und verdoppeln. Das war 2010 schon eine sehr ehrgeizige Annahme. Ohne dass sich etwas an den Rahmenbedingungen geändert hat, werden jetzt die Laufzeiten der Kernkraftwerke massiv reduziert, aber es werden keine schlüssigen Antworten gegeben wie unsere Versorgung gesichert wird bzw. wie ein Anstieg der Strompreise verhindert werden kann. Wenn die Politik ihren eigenen Ausstiegsbeschluss ernst nehmen würde, müsste man jetzt anfangen die angedachten Alternativen ebenso schnell einzuleiten wie der Ausstiegsbeschluss gefasst wurde. D.h. wir müssten schon jetzt Gaskraftwerke bauen, unabhängig davon wie schnell die Methanisierung vorankommt.
Bei der Methanisierung müssten sofort mehrere Pilotanlagen in Angriff genommen werden und parallel die Entwicklung von großtechnischen Anlagen zur Methanisierung vorangetrieben werden. Wir würden dann zwar in Deutschland das ‚Lehrgeld‘ für den Rest der Welt bezahlen, hätten aber mit etwas Glück danach auch gute Exportchancen. Der große Wurf, dass da jetzt schnell was passiert, zeichnet sich aber nicht am Horizont ab.
Es bleibt spannend mit der Energiewende und wir danken Ihnen für dieses Gespräch.
Der 46-jährige Professor aus dem Hunsrück lehrt seit 2003 an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften, der Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt Energietechnik,
Technische Thermodynamik und Wärmeübertragung. Einer seiner Schwerpunkte sind regenerative Energiesysteme. Er ist Mitglied im Ausschuss Anlagen- und Systemtechnik der Reaktorsicherheitskommission. Paulus lebt in Poppenhausen, ist verheiratet und Vater von zwei Töchtern.
Aus der Ausgabe 07/08/2011 SWmagaz.in